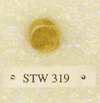D2600 - Homo erectus (ergaster, georgicus)
| FUND | FUNDORT | ALTER | ENTDECKER | DATUM |
|---|---|---|---|---|
| Unterkiefer | Dmanisi Georgien | 1,8 Millionen Jahre | Abesalom Vekua, David Lordkipanidze | 2001 |
| VERÖFFENTLICHUNG | ||||
| Vekua A., Lordkipanidze D., Rightmire G.P., Agusti J., Ferring R., Maisuradze G. et al. 2002. A new skull of early Homo from Dmanisi, Georgia.Science, 297:85-9. DOI: 10.1126/science.1072953 | ||||
Der Unterkiefer D2600 ist das Typusexemplar für Homo georgicus und wurde im September 2000 an der als Jahrhundertfundstelle bezeichneten Grabungsstelle Dmanisi, Georgien entdeckt [1]. Er gehörte offensichtlich zu einem erwachsenen Individuum, denn in ihm steckten bis auf das Zahnbein abgetragene Zähne. Das Fundstück weist ungewöhnlich große Dimensionen auf, so übertrifft die Länge des Kieferbogens alle frühen Vertreter der Gattung Homo – gleich ob in Dmanisi, Afrika oder Asien.
Der Bereich des Unterkiefers unter den Schneidezähnen ist knapp fünf Zentimeter hoch. (Zum Vergleich: D211: drei Zentimeter), die Wurzeln der Eckzähne treten außen stark hervor. Diskutiert wird, ob der Kiefer einer eigenen Art (H. georgicus) zugeordnet oder mit in die Variationsbreite der H. erectus/H. ergaster -Gruppe gezählt werden sollte.
Das erste Fundstück, das die Grabungsstelle Dmanisi am 24.09.1991 hervorbrachte hat die Bezeichnung D211 [2] und ist ebenfalls ein Unterkiefer mit kompletter Bezahnung. Er gehörte vermutlich einem 20- bis 25-jährigen Individuum. Günter Bräuer (Hamburg) und Michael Schultz (Göttingen) wiesen durch den detaillierten Vergleich mit 40 afrikanischen, asiatischen und europäischen Homininenfossilien insgesamt die Ähnlichkeit zu Homo erectus nach. Von dessen afrikanischen Frühformen (=Homo ergaster), zum Beispiel dem 1,6 Millionen Jahre alten Fundstück KNM-ER 992 vom Ostufer des Turkanasees in Kenia, unterscheidet sich D211 durch progressive Merkmale wie Kinnentwicklung und die kleiner werdende Kaufläche vom ersten bis dritten Mahlzahn.
Die lehmige Fundschicht wurde geomagnetisch auf 1,95 bis 1,77, der Basalt darunter auf 1,8 Millionen Jahre datiert. Dazu passen auch mit aufgefundene Fossilien der Nagetier-Gattung Mimomys, die bis vor 1,6 Millionen Jahren gelebt hat. Da der Kiefer selbst mehr einem späteren Homo erectus ähnelt und seine Fundschicht sekundär eingetragenes Material aufweist, ergaben sich zunächst widerstreitende Altersangaben zwischen einer Million und 1,8 Millionen Jahren.
Im Mai und Juli 1999 folgten dann die beiden Schädel mit den Nummern D2280 und D2282 [3]. Bei ersterem handelt es sich um einen weitgehend erhaltenen Hirn- und Gesichtsschädel (Calvarium) eines männlichen erwachsenen Individuums. Das Hirnvolumen beträgt 775 Kubikzentimeter und der Schädel hat ausgeprägte Überaugenwülste; in Aufsicht weist er dahinter (postorbital) eine markante Einschnürung auf; auf dem Scheitel ist ein »Kiel« ausgeprägt. Eine neuerliche Datierung des Basalts am Fundort ergab 1,85, eine Basaltdatierung in der Nachbarschaft 1,77 Millionen Jahre. Konservative Altersangabe für alle Dmanisi-Fossilien seither: 1,75 Millionen Jahre.
Bei dem Schädel vom Juli 1999 mit der Bezeichnung D2282 handelt es sich um ein fast komplettes Calvarium eines jungerwachsenen oder erwachsenen weiblichen Individuum. Das Hirnvolumen beträgt 650 Kubikzentimeter; Überaugenwülste, postorbitale Einschnürung und Scheitel-Kiel wie D2280. Der Schädel hat sich durch die Einlagerung ins Sediment leicht verformt.
Obwohl die Gehirngröße von D2282 (650 cm³) kleiner als bei jedem bekannten Homo erectus-Fossil war (nahe der durchschnittlichen Homo habilis-Gehirngröße), wies Gabunia auf die vielen Ähnlichkeiten von D2280 und D2282 mit Homo erectus-Fossilien wie WT 15000 und ER 3733 hin:
»Trotz ihrer relativ kleinen Schädelkapazitäten unterscheiden sich beide Dmanisi-Fossilien von Homo rudolfensis und Homo habilis und zeigen eine Anzahl wesentlicher Ähnlichkeiten mit den Schädeln von Homo erectus und besonders mit seinen frühen afrikanischen Formen, die von einigen Wissenschaftlern dem Homo ergaster zugeschrieben werden.«
Im Jahr 2001 folgte dann der Fund eines Schädels mit der Bezeichnung D2700 einschließlich des Unterkiefers (D2735) [4]. Dass beide Stücke zu ein und demselben Individuum gehören, wird mit dem geringen Abstand der Fundlage von nur einem Meter begründet. Der bis auf wenige Beschädigungen vollständig erhaltene Hirn- und Gesichtsschädel sowie der Unterkiefer gehörte einem jugendlichen Individuum, da die Weisheitszähne im Oberkiefer noch nicht vollständig durchgebrochen waren [3]. Die Mehrheit der Merkmale passt zu Homo erectus/Homo ergaster; das Hirnvolumen liegt mit 600 Kubikzentimetern jedoch noch unterhalb der für diese Gruppe üblichen Werte und näher bei deren Vorgänger Homo habilis. Auch die nur schwachen Überaugenwülste weisen in diese Richtung. Mit 600 cm³ Gehirnvolumen ist dieser Schädel noch kleiner als D2282 und sieht primitiver aus. Abesalom Vekua listet viele Merkmale auf, in denen das Fossil Homo ergaster (oder erectus) ähnlich ist [3], ebenfalls gibt es zahlreiche Ähnlichkeiten mit dem habilis-Schädel ER 1813.
Allerdings befanden die Autoren die Unterschiede zwischen den drei Dmanisi-Schädeln nicht für groß genug, um sie unterschiedlichen Spezies zuzuordnen:
»Umfassend betrachtet ähneln sich die drei Dmanisi-Schädel (D2700, D2280, D2282) sehr, ebenso wie die beiden Unterkiefer (D211, D2735). Trotz gewisser Unterschiede unter den Individuen sehen wir keine hinreichenden Grundlagen dafür, sie mehr als einem homininen Taxon zuzuweisen. Wir sehen die neuen Fundstücke als Mitglieder der gleichen Population an wie die anderen Fossilien, und wir weisen hier den neuen Schädel [....D2700] vorläufig Homo ergaster zu (=erectus)« [4].
In einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2002 im Fachmagazin Nature wurden all diese Fundstücke der neuen Spezies Homo georgicus zugewiesen, wobei das Fossil D2600 als Vorlagenmuster benutzt wurde [1]. In dieser Arbeit wird die Körpergröße von Homo georgicus (ausgehend von einem Fußknochen) auf ungefähr 1,50 m und das Körpergewicht auf 40 - 50 kg geschätzt.
In den Jahren 2002 und 2003 folgte dann in der Fossilaufzeichnung aus Dmanisi der Schädel D3444 mit dem zugehörigen Unterkiefer D3900. Die Überreste gehörten einem adulten Homo erectus.
Alle Individuen, deren Überreste man in Dmanisi fand, sollen innerhalb eines Zeitraums von etwa 10.000 Jahren gelebt haben.
Folgen der Dmanisi-Funde für die Out-Of-Africa-Hypothese
Bis vor kurzem glaubte man, dass die ersten Homininen, die Afrika verließen, der Art Homo erectus/ergaster angehörten. Und dass die Auswanderung aus Afrika erst stattfand, nachdem Homo erectus die mehr oder weniger moderne Körperform entwickelt hatte, wie das beim Turkana-Boy-Fossil der Fall ist. Die Entdeckung der Dmanisi-Schädel, besonders des Schädels D2700, erhöht nun die Möglichkeit, wie von Vekua et al. vorgeschlagen, dass die Dmanisi-Homininen von habilis-ähnlichen Vorfahren abstammen könnten, die Afrika bereits verlassen hatten. Demzufolge würde dies eine Neubewertung von Theorien nötig machen, wann, warum und welche Homininen zuerst Afrika verließen.
Literatur
[1] Léo Gabounia, Marie-Antoinette de Lumley, Abesalom Vekua, David Lordkipanidze, Henry de Lumley: Découvert d'un nouvel hominidé à Dmanissi (Transcaucasie, Géorgie). In: Comptes Rendus Palevol. Band 1, 2002, S. 243–253, DOI:10.1016/S1631-0683(02)00032-5 und – mit Abb. – Sciencemag
[2] Leo Gabunia, Abesalom Vekua: A Plio-Pleistocene hominid from Dmanisi, East Georgia, Caucasus. in: Nature. Band 373, 1995, S. 509–512, DOI:10.1038/373509a0
[3] Leo Gabunia, Abesalom Vekua, David Lordkipanidze et al. Earliest Pleistocene Hominid Cranial Remains from Dmanisi, Republic of Georgia. Taxonomy, Geological Setting, and Age. Science, Band 288, 2000, S. 1019–1025,DOI:10.1126/science.288.5468.1019
[4] Abesalom Vekua, David Lordkipanidze u.a.: A new skull of early Homo from Dmanisi, Georgia. Science, Band 297, 2002, S. 85–89, DOI:10.1126/science.1072953