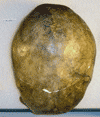Die Entdeckung der Vorzeit
«Alle Menschen haben das natürliche Verlangen, zu wissen», hatte schon Aristoteles erkannt. Im Europa der Renaissance steigerte sich dieses Verlangen, beflügelt durch die neue Kunst des Buchdrucks, zu der Entwicklung der modernen Naturwissenschaften.
Die Machtprobe zwischen Glauben und Wissen forderte ihre Opfer: Der italienische Philosoph Giordano Bruno endete im Jahr 1600 auf einem Scheiterhaufen der römischen Inquisition. Galileo Galilei, der größte Denker seiner Zeit, mußte unter Androhung der Folter 1633 vor der Inquisition dem neuen wissenschaftlichen «Irrglauben» des kopernikanischen Weltbildes abschwören und den Rest seines Lebens unter striktem Hausarrest verbringen. Der Drang, es genauer wissen zu wollen, machte freilich auch nicht vor der Kirche halt. So errechnete anno 1650 James Ussher, Erzbischof im irischen Armagh, nach intensivem Bibelstudium, dass die Schöpfung im Jahr 4004 v.Chr. stattgefunden haben muß.
Einhundert Jahre nach Ussher bestimmte der französische Naturforscher Comte de Buffon in einem ersten zaghaften naturwissenschaftlichen Versuch, dass die Erde mindestens 70.000 Jahre alt sein müsse. Schon wenige Jahre später schrieb der Königsberger Philosoph Immanuel Kant, dessen «Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels» (1755) die erste detaillierte Theorie der kosmischen Evolution war, von Millionen und sogar von Hunderten von Millionen Jahren.
Während des 18. Jahrhunderts begannen Naturforscher, immer mehr seltsame Knochen aus der Erde zu graben, die immer schwerlicher existierenden Tieren zugeordnet werden konnten. Sie erkannten, dass die Tiefe der Fundstelle im Erdreich in engem Zusammenhang mit dem Alter der Fossilien stehen mußte. Der französische Geologe Baron Georges Cuvier (1769 bis 1832) machte einen zunächst erfolgreichen Versuch, noch einmal die Aussagen der Bibel und die Beobachtungen der Forscher unter einen Hut zu bringen: Er ging davon aus, dass von Zeit zu Zeit gewaltige Katastrophen - darunter die biblische Sintflut - die Erde heimgesucht und dabei jeweils alles Leben ausgelöscht hätten. Danach habe Gott die Welt immer wieder neu (und besser) erschaffen. Cuviers Katastrophenlehre fand rasch Anhänger, die alsbald 32 verschiedene Gesteinsschichten - und damit ebenso viele Sintfluten - ausgemacht haben wollten.
Immerhin gingen die Katastrophisten von einer erdgeschichtlichen Entwicklung aus, bei der die Zeit wie ein Pfeil von der Vergangenheit in die Zukunft gerichtet ist. Dagegen betrachteten die Anhänger der konkurrierenden Theorie des tAktualismusT die Entwicklung der Erde als einen Kreislauf: Demnach finden Veränderungen nur äußerst langsam statt, und zwar nach auch heute noch - also taktuellT - wirksamen Prozessen wie etwa der Erosion des Gesteins durch laufendes Wasser.
Nach dem Motto, «die Gegenwart ist der Schlüssel zur Vergangenheit» und «die Natur macht keine Sprünge», trug der Schotte Charles Lyell mit akribischer Genauigkeit Beweise für eine stetig, sich gleichförmig verändernde Erde zusammen. Seine dreibändigen «Prinzipien der Geologie» (1830-33) gelten heute als Grundstein der modernen Erdwissenschaften.
Der Kern von Lyells Lehre, wonach geologische Prozesse langsam und gleichmäßig ablaufen, sollte sich als nahezu korrekt herausstellen (auch wenn sein strenger «Gradualismus» Klimakatastrophen wie die Eiszeit ausschloß). Seine Vorstellung von einem ewigen Kreislauf der Erdgeschichte erwies sich dagegen als falsch: Die Entwicklung der Erde läuft, wie von den Katastrophisten (und der christlichen Glaubenslehre) angenommen, von einem Anfang zu einem Ende.
Einig waren sich die Anhänger von Cuvier wie von Lyell, dass die Fossilienfunde aus dem Bauch der Erde die Überbleibsel ausgestorbener Tiere sein mußten. Die Paläontologie, die Lehre von den Lebewesen vergangener erdgeschichtlicher Epochen, gewann zusehends an Bedeutung, und im Jahr 1842 schlug einer der besten Paläontologen seiner Zeit, der Brite Richard Owen, seinen Kollegen vor, einer ausgestorbenen «Gruppe oder Unterordnung echsenartiger Reptilien» den Namen «Dinosaurier» zu geben.