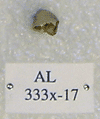Anatomische Terminologie
Die Lage- und Richtungsbezeichnungen dienen in der Anatomie zur Beschreibung der Position und des Verlaufs einzelner Strukturen. Zum Teil sind diese Bezeichnungen auch Bestandteil anatomischer Namen. Während sich klassische Lagebezeichnungen wie „oben“ oder „unten“ je nach Körperposition ändern, sind die anatomischen Lagebezeichnungen relativ und damit unabhängig von der Position des Körpers.
Generelle Lage- und Richtungsbezeichnungen
median: in der Mitte gelegen
medial: zur Mitte hin gelegen
paramedian: neben der Mitte gelegen
lateral (von lat. latus = Seite): zur Seite hin gelegen
ipsilateral: auf der gleichen Seite befindlich
kontralateral: auf der gegenüberliegenden Seite befindlich
parietal: zur Wand eines Organes oder zur Leibeswand gehörig; seitlich, wandständig; zum Scheitel gehörend
viszeral: die Eingeweide betreffend, zu den Eingeweiden gehörend
dorsal* (dorsum = Rücken): rückenwärts
ventral* (venter = Bauch): bahseitig bzw. am Bauch gelegen
kranial * (cranium = Schädel): zum Schädel hin (beim Menschen also oben, bei Tieren vorn)
kaudal* (cauda = Schwanz): zum Schwanze hin (beim aufrecht stehenden Menschen also unten, bei Tieren hinten)
*Diese vier Bezeichnungen können kombiniert werden, wobei die Endsilbe (Suffix) des ersten Begriffs durch „o“ ersetzt wird: z. B. kraniodorsal (kopf-rückenwärts).
sakral (sacrum): zum Kreuzbein (Os sacrum) hin gelegen
terminal: am Ende gelegen
ektop: am falschen Ort gelegen
In Bezug auf die Medianebene unterscheidet man die beiden Körperhälften:
dexter: rechts
sinister: links
In Bezug auf das Körperzentrum werden die Begriffe:
proximal (proximus = der Nächste): zum Körper hin gelegen oder verlaufend
distal (distare = sich entfernen): vom Körper entfernt gelegen oder verlaufend
Im Bereich des Rumpfes werden in der Humananatomie häufiger die Begriffe:
anterior = vorn liegend = ventral
posterior = hinten liegend = dorsal
inferior = unten liegend = kaudal
superior = oben liegend = kranial
verwendet. Diese Begriffe sind in der Tieranatomie ausschließlich am Kopf erlaubt!
Zusätzliche Lage- und Richtungsbezeichnungen am Kopf
Am Kopf ist die Bezeichnung kranial nicht sinnvoll, für vorn orientierte Strukturen verwendet man daher die Begriffe:
rostral (rostrum = Schnabel, Rüssel): schnabel-, schnauzenwärts
oral (os = Mund): mundwärts
hemikraniell von griech. ημικρανίον, hemikranion, hemikrania - halber Schädel
Für hinten liegende Strukturen verwendet man auch den Begriff:
aboral: vom Mund weg gelegen
okzipital (Occiput = Hinterhaupt): zum Hinterkopf hin gelegen (vgl. Hinterhauptsbein)
Statt lateral und medial verwendet man am Kopf, insbesondere am Auge, auch die Begriffe:
temporal (tempus = Schläfe): schläfenwärts, also seitlich (lateral)
nasal (nasus = Nase): nasenwärts, zur in der Mitte gelegenen Nase hin (medial)
Durch die mögliche Rotation des Unterschenkels und des Unterarms sind die Bezeichnungen lateral und medial nicht eindeutig definiert. Daher spricht man normalerweise von radial statt lateral bzw von ulnar statt medial am Unterarm und in gleicher Weise von fibular und tibial am Unterschenkel.
Lage- und Richtungsbezeichnungen an den Zähnen
Am Zahn werden spezielle Bezeichnungen verwendet. Wegen der Krümmung des Zahnbogens wurde hier die Lagebezeichnung mesial eingeführt, denn medial wäre an den Schneidezähnen die zur Mitte liegende Kontaktfläche zum Nachbarzahn, jedoch an den Mahlzähnen die palatinale Fläche und an den Eckzähnen irgend ein Mittelding.
okklusal: zur Okklusionsfläche (Kaufläche) hin
lingual (lingua = Zunge): zungenseitig
palatinal (palatum = Gaumen): gaumenseitig
labial (labium = Lippe): lippenseitig
bukkal (bca = Backe): backenseitig
mesial: zur Mitte des Zahnbogens hin
distal: zum Ende des Zahnbogens hin
apikal (apex = Spitze): zur Wurzelspitze hin
koronal (corona = Krone): zur Zahnkrone hin
inzisal: zu Schneidekante hin
mastikal: zur Kaufläche hin
zervikal: zum Zahnhals hin
approximal: zu den Nachbarzähnen hin
vestibulär: (vestibulum = Vorhof) zum Mundhöhle hin (Achtung: in der Neurologie bezieht sich „vestibulär“ auf das Gleichgewichtsorgan)
krestal: 1.) Richtungsbezeichnung für „vom Kieferkamm her“ 2.) im Bereich des knöchernen Alveolarrandes (Limbus alveolaris) oder an der Crista alveolaris; Arcus alveolaris
Zur Vermeidung von Missverständnissen werden die Zähne des Menschen in der Zahnheilkunde durch die Zahnformel eindeutig bezeichnet. Das Gebiss wird dazu in 4 Quadranten unterteilt, d. h. pro Kiefer erfolgt die Teilung zwischen den mittleren Schneidezähnen. Diese Quadranten dienen als erste Ziffer der Zahnbezeichnung:
oben rechts = 1 (bei Milchzähnen: 5)
oben links = 2 (bei Milchzähnen: 6)
unten links = 3 (bei Milchzähnen: 7)
unten rechts = 4 (bei Milchzähnen: 8)
Die einzelnen Zähne werden dann jeweils von vorn beginnend durchnummeriert. Der linke untere Weisheitszahn trägt somit die Bezeichnung 38 (sprich: drei-acht), während der erste obere linke Schneidezahn als 21 (sprich: zwei-eins) bezeichnet wird.
Verlaufsbezeichnungen
In Bezug auf die 3 Körperebenen (Horizontalebene, Frontalebene, Medianebene) werden unterschieden:
transversal: quer zur Körperlängsachse
longitudinal: entlang der Körperlängsachse
sagittal (sagitta = Pfeil): parallel zur Medianebene
median: in der Medianebene
aszendierend (ascensus = Aufstieg): aufsteigend
deszendierend (descensus = Abstieg): absteigend
Freie Lage- und Richtungsbezeichnungen
Neben diesen generellen Lagebezeichnungen ist es praktisch möglich, aus allen Körperteilen Lage- bzw. Richtungsbezeichnungen zu kreieren. Dazu wird der lateinische Wortstamm des Körperteils/Organs mit der Endsilbe -al versehen: z.B. intestinal (intestinum = Darm), thorakal (thorax = Brustkorb), abdominal (abdomen = Bauch) usw.