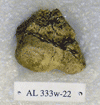Was ist eine Eiszeit
Eigentlich ist die Erde ein wohltemperierter Planet. Der "richtige" Abstand zur Sonne ermöglichte erst Leben und erhielt es dann über Milliarden von Jahren hinweg. Die irdische Wärmemaschine, dieses hochkomplizierte System aus Ozean und Atmosphäre, sorgte für die meiste Zeit der Erdgeschichte für laue Lüftchen.
Ab und zu brechen freilich Klimakatastrophen über das sommerliche Paradies herein. Vor 600 Millionen Jahren, das verraten die Schleifspuren der Gletscher im Fels, bedeckten Eismassen weite Teile Afrikas, Südamerikas, Indiens und Australiens. Vor 250 Millionen Jahren, als die Reptilien sich anschickten, das Festland zu erobern, brach abermals die globale Wärmebalance zusammen.
Nach 230 Millionen Jahren sommerlichen Klimas begannen die Temperaturen dann weltweit wieder zu sinken. Bis vor 18 Millionen Jahren war die Abkühlung fast unmerklich, doch dann, mit immer heftigeren Pendelausschlägen, kehrten vor etwa zwei Millionen Jahren frostige Zeiten für das nördliche Drittel der Erde zurück.
Anders als in einer immer noch weitverbreiteten Vorstellung glich "die Eiszeit" freilich keineswegs einer einzigen eisgepanzerten Ära. Vielmehr wurde das Pleistozän, wie die Geologen die frostige Epoche nennen, von vielen Klimaschwankungen geprägt, die eisigen Abschnitten wieder freundliches Tauwetter folgen ließen. In den Tropen blieb es auch während der größten Gletschervorstöße angenehm warm. Als Forscher im letzten Jahrhundert in Süddeutschland auf die Spuren von vier großen Wachstumsperioden der Alpengletscher stießen, nannten sie die vier Vorstöße nach vier dort fließenden Flüssen Günz-, Mindel-, Riß- und Würm-Eiszeit.
Schon in Norddeutschland, das während der Vereisungsperioden von den kilometerdicken Eismassen des Skandinavischen Eisschildes bedeckt war, ging diese saubere Einteilung freilich nicht mehr auf. Erst mit den ungestörten Ablagerungen, die sich am Boden der Ozeane durch einen ständigen Regen von mikroskopisch kleinen Kalkskeletten abgestorbener einzelliger Meerestiere (den Foraminiferen) bilden, gelang es, den Verlauf der eiszeitlichen Klimaschwankungen korrekt nachzuzeichnen. Demnach gab es in den letzten zwei Millionen Jahren 18 bis 20 Vereisungszyklen, die jeweils höchstens 10.000 Jahre dauerten und von langen, zum Teil angenehm temperierten "Zwischeneiszeiten" unterbrochen waren. Wir leben heute in so einer Zwischeneiszeit.
Wie entsteht eine Eiszeit?
Wissenschaftler zitieren kosmische und irdische Katastrophen, um den plötzlichen Temperatursturz nach 230 Millionen Schönwetter-Jahren plausibel zu machen: Staubwolken aus dem All, die das Sonnenlicht abschatteten; Planeten, die in die Sonne stürzen und das Feuer in unserem Muttergestirn für einige Zeit abschwächen; Vulkane, die einen dichten Ascheschleier um die Erde legen.
Wahrscheinlich muß ein ganzes Bündel von Ursachen zusammenwirken, damit die Gletscher wachsen können. Dabei spielt die Kontinentalverschiebung die Hauptrolle: Nur wenn sie Landmassen nahe genug an den Nord- oder Südpol schiebt, können sich darauf Eismassen ansammeln - so wie heute noch auf dem total vergletscherten Kontinent Antarktika. Dann muß eine erhöhte Wärmeabstrahlung von der Erde - etwa durch vergrößerte Landflächen - oder eine verminderte Sonneneinstrahlung für die sinkenden Temperaturen sorgen.
An weniger Wärme von der Sonne können Vorgänge in der Sonne selbst, aber auch die Unregelmäßigkeiten der Erdbahn, die schwankende Erdachse sowie heftige Vulkanausbrüche schuld sein - einzeln oder gebündelt. Haben sich erst einmal Gletscher gebildet, dann verstärkt sich die Vereisung zunächst selbst, weil die hellen Schnee- und Eisflächen mehr Sonnenlicht zurück in den Weltraum reflektieren, so dass die Temperaturen weiter fallen.
Durch einen noch nicht völlig verstandenen Rückkopplungsprozeß bewirken nach einiger Zeit die ozeanischen und atmosphärischen Strömungen, dass die Eiskappen nicht mehr genug Nachschub in Form von Schnee bekommen - und dadurch gleichsam verhungern. Eine wesentliche Rolle bei diesem rhythmischen Anwachsen und Abschmelzen spielt die Sonnen-Einstrahlung, die auf der Erde ankommt. Der Physiker Milutin Milankovitch übertrug die sich überlagernden Einflüsse der Erdbahn- und Polachsen-Schwankungen auf eine Klimakurve - und erhielt einen Warmzeit-Kaltzeit-Rhythmus, der recht gut mit der bekannten Eiszeit-Abfolge übereinstimmt.
Die Eiszeit war mit dem letzten Rückgang der Gletscher vor rund 10.000 Jahren noch nicht zu Ende. Wir leben in einer Zwischeneiszeit, und die freundlichste Periode dieser Warmzeit liegt bereits hinter uns. In weiteren 10.000 Jahren könnten die Eismassen wieder vor Berlin stehen.
Wo Gletscher alles niederwalzen, da bleibt kein Platz fürs Leben. Und doch brachte die Eiszeit eine erstaunliche Fülle neuer Tier- und Pflanzenformen hervor. Die Wechselbäder rasch aufeinanderfolgender Kalt- und Warmzeiten waren eine tödliche Gefahr - Und eine Chanche für die Evolution: ähnlich wie ein Läufer auf dem Fließband, der rennt und doch nicht von der Stelle kommt, mußten die Spezies der Eiszeit sich im Eiltempo neuen Umweltbedingungen anpassen, um zu überleben.
Den Sturz der Temperaturen illustrieren am besten die mittleren Jahrestemperaturen an einem Ort wie Frankfurt am Main, an dem heute im Jahresmittel neun bis zehnGrad Celsius herrschen: Im Eozän, dem goldenen Zeitalter der Säugetiere, herrschten mit durschnittlich 21 Grad Celsius Temperaturen wie heute im ägyptischen Niltal; im Pliozän, kurz vor dem Beginn der Eiszeit, war es im Mittel schon um sieben Grad kühler; während der Vereisungsperioden verwandelte der Eishah die einst blühende Landschaft in eine Tundra mit dauernd gefrorenem Boden.
In den - geologisch gesehen - sehr kurzen Zeiträumen der eigentlichen Vereisung whsen die Gletscher in Nordamerika und Europa zu gigantischen, bis zu vier Kilomer mächtigen Eispanzern an. Sie bedeckten zur Zeit der größten Vereisung in Europa 5,5 Millionen Quadratkilometer und in Nordamerika gar 15 Millionen Quadratkilometer (dazu kamen noch die kleineren Gletschergebiete in Hochgebirgen wie den Alpen).